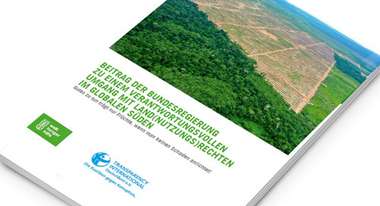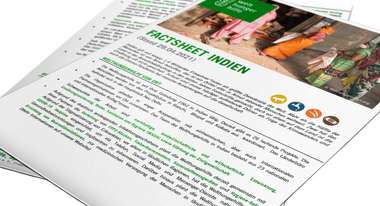Zivilgesellschaft stärken
Die Welt verändert sich – und mit ihr die Anforderungen an die Entwicklungszusammenarbeit. Die Schere zwischen Arm und Reich ist riesig. In strukturschwachen Ländern untergräbt dies die gesellschaftliche Stellung und das Mitspracherecht der von Armut betroffenen Menschen. Hunger wird zusätzlich verschärft. Wie kann dieser Kreislauf gestoppt werden?
Ein wichtiger Schritt ist der Aufbau einer aktiven Zivilgesellschaft. Die Vereinten Nationen geben mit den 17 Nachhaltigkeitszielen den Rahmen vor. Und die menschenrechtsbasierte Advocacy-Strategie der Welthungerhilfe setzt Maßstäbe in der Entwicklungszusammenarbeit. Sie nimmt die Agenda 2030 beim Wort, niemanden zurückzulassen. Nur eine starke Zivilgesellschaft sorgt für soziale Gerechtigkeit und mit ihr für eine Welt ohne Hunger.
Anforderungen an die Entwicklungszusammenarbeit
Bei der Überwindung des weltweiten Hungers geht es aber nicht nur um finanzielle Hilfen, materielle Unterstützung oder die Produktion von Nahrungsmitteln, sondern auch um Ursachenbekämpfung. Aus einer Bevölkerung sollen selbstbestimmte und organisierte Akteure werden, die dabei unterstützt werden, ihre Rechte wahrzunehmen.
Dies geschieht durch:
- Stärkung der Zivilgesellschaften
- Aufbau gesellschaftlicher Strukturen / Unterstützung lokaler Gruppen
- Förderung eines fairen Handels
- Schaffung von beruflichen Bildungs- und Aufstiegschancen
- Lokale, nationale, regionale und internationale Netzwerkarbeit
- Regelmäßiges Monitoring & systematische Feedbackmechanismen
- Transparenz und Accountability (Rechenschaft)
- Kooperation mit Schlüsselpartnern der Zivilgesellschaft für eine inklusive und gerechte Entwicklung
- Qualifizierung (Capacity Development) von Partnerorganisationen
Aktive Zivilgesellschaften an der Basis stärken
Den Menschen, Gemeinden oder Partnerorganisationen vor Ort soll sowohl auf nationaler wie auf internationaler Ebene eine Stimme verliehen werden. Denn als freiwillige Maßnahme wirkt die Agenda 2030 Missständen in der Regierung nicht aktiv entgegen. Ein Dialog zwischen Bürger*innen und Staat gelingt nur auf Augenhöhe. Stark werden Zivilgesellschaften im Zusammenschluss. Sie darin zu unterstützen sowie sie über ihre Rechte aufzuklären, ist ein wichtiger Schritt zur Demokratie.
Kompetenzen fördern, Wissen vermitteln
Für eine dauerhafte Stärkung ihrer Verhandlungsposition ist Wissensvermittlung entscheidend. Unsere lokalen Partnerorganisationen bilden daher Führungspersönlichkeiten durch Trainings und Konferenzen zu unterschiedlichen Schwerpunkten aus. Hungerbekämpfung bleibt ein multidimensionales Feld: Fairer Handel, Zugang zu Bildung für junge Menschen, Gesundheitsinfrastruktur sowie Geschlechtergerechtigkeit sind Bereiche, die die Welthungerhilfe ebenso berücksichtigt.
Indien: Demonstrationen von Bürger*innen erfolgreich
In Indien mobilisierte die Welthungerhilfe mit ihren Partnern während der Dürre 2016 ein breites Bündnis, das den Staat zum Handeln brachte. Tausende Kleinbäuer*innen beteiligten sich bei Großdemonstrationen in Delhi. Inzwischen fördert die Regierung traditionelle Wassersysteme in den dürregeplagten Dörfern. Die Menschen sind stolz auf ihren Erfolg.
In Äthiopien übernehmen die Partnerorganisationen eigenverantwortlich die „klassischen“ technischen Projekte der Welthungerhilfe. Die Expert*innen aus dem Landesbüro beraten sie auf Organisationsebene selbstverständlich weiter. In Kambodscha und weiteren Ländern hat sich die Civil Society Academy (CSA) etabliert. Seit 2014 fördert sie zivilgesellschaftliche Organisationen, indem sie Talente und Kompetenzen mit dem Ziel schult, Menschen und im Kampf gegen Hunger, Landraub und Ungleichheit zu befähigen. Dabei werden Führungspersönlichkeiten ausgebildet, Netzwerke organisiert und Konferenzen sowie eine Plattform für Wissensmanagement entwickelt. Seit März 2023 arbeitet die CSA unabhängig von der Welthungerhilfe.