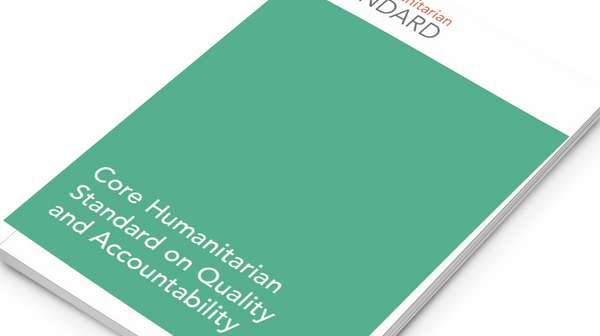Indem wir die Wirkung unserer Programme messen, können wir Erfolge und Misserfolge kritisch bewerten – und daraus lernen.
Qualitätsmanagement
Aus Erfolgen und Fehlern lernen: Wie das Ausrichten an angestrebten Veränderungen und das Reflektieren von Erfolgen und Misserfolgen die Organisation voranbringt.

Die Bedeutung von Qualität
Qualität in der (Projekt-)Arbeit – für die Welthungerhilfe heißt das:
- Gemeinsam Veränderungen auf den Weg bringen: Die angestrebten Wirkungen eines Projektes, die Ziele also, mit den Projektbeteiligten gemeinsam zu definieren und zu beurteilen. Im Idealfall lernen dabei die Welthungerhilfe und die Projektbeteiligten gleichermaßen und ihre Handlungsfähigkeit in Bezug auf die Gestaltung des Projektes und Verbesserung ihrer Lebenssituation erhöht sich.
- Voraussetzungen für Beteiligung schaffen: Die in Armut lebenden Menschen sollen an Veränderungsprozessen aktiv mitwirken können. Die Welthungerhilfe stellt daher sicher, dass Foren zur Beteiligung institutionalisiert sind, der Zugang zu relevanten Informationen sichergestellt ist, transparent kommuniziert wird und Beschwerden nicht tabuisiert, sondern als Anlass zum Dialog gesehen werden.
- Leuchtturm und Messlatte „Wirkung“: Bei der Planung und Beurteilung von Projekten auf angestrebte Wirkungen ausgerichtet sein. Darüber hinaus hat die Welthungerhilfe den Anspruch, weiteren (Qualitäts-)Standards zu genügen: Nachhaltigkeit der Arbeit und die Ausrichtung an den Bedürfnissen zum Beispiel, sowie auch ein effizienter Mitteleinsatz.
- Schätze (hervor)heben; mutig Lücken erkennen und schließen: Erfahrungen werden systematisch und kritisch reflektiert, um aus Erfolgen und Misserfolgen gleichermaßen zu lernen und um besser zu werden.
- Rechenschaft ablegen: Konnte das Vorhaben wie geplant umgesetzt und die Ziele erreicht werden? Wie sieht es aus mit effizientem Mitteleinsatz, Nachhaltigkeit und Relevanz? Antworten auf diese Fragen liefern zu können, sieht die Welthungerhilfe als ihre Verpflichtung gegenüber Spendern, institutionellen Gebern und Projektbeteiligten an.
Eine Sammlung von Dokumenten zum Thema Qualitätsmanagement bei der Welthungerhilfe.
Wie lassen sich Qualität und Qualitätssteigerung erzielen?
Bereits bei der Planung von Vorhaben greift die Welthungerhilfe nach Möglichkeit auf bereits gemachte Erfahrungen zurück, welche aus dem Monitoring oder der Evaluation ähnlicher Projekte vorliegen.
Ausgangspunkt der Projektplanung ist die Identifikation von Problemen und Potentialen mit den Betroffenen vor Ort und die Entwicklung einer Projektidee mit dem Ziel, die Situation vor Ort mittel- oder langfristig zu verbessern bzw. zu stabilisieren. Diese Projektideen werden bei Bedarf weiter mit entsprechenden Fachabteilungen aus der Zentrale diskutiert, auch um potenzielle negative Wirkungen schon vorab zu antizipieren und Gegenmaßnahmen ins Projekt zu integrieren.
Die Projektplanungen durchlaufen einen internen, standardisierten Bewilligungsprozess, bevor auch die institutionellen Geber über die Qualität des Vorhabens befinden. Schon bei der Planung liegt die Wirkung im Fokus. Wie Wirkungen beobachtet und dokumentiert werden sollen, um dann für die Reflexion über etwaige Korrekturmaßnahmen zur Verfügung zu stehen, wird auch schon in der Planungsphase festgelegt. Damit ist der Grundstein für gutes Monitoring und Evaluationen gelegt.
Wirkungsorientierung
Wirkungsorientierung bedeutet für die Welthungerhilfe
Maßstab ihrer Arbeit ist für die Welthungerhilfe, das Leben der in Armut lebenden Menschen zu verbessern. Es geht zum Beispiel nicht nur um die konkrete Projekt-Maßnahme „Schulung von Kleinbauern-/bäuerinnen zum Thema klimaangepasste Anbaumethoden“, sondern entscheidend dabei ist, inwiefern das Wissen genutzt wird. Denn das eigentliche Ziel ist es, die Ernährungssituation der Kleinbauern und ihrer Familien nachhaltig zu verbessern. Wichtig ist also die Wirkung, nicht nur die von Projekten erbrachten (Dienst-)Leistungen.
Monitoring und Evaluationen erfassen nicht nur, inwieweit die beabsichtigte Wirkung erzielt wurde, sondern auch inwieweit die Arbeit einen Beitrag zur Zielerreichung geleistet hat. Unter Berücksichtigung des jeweiligen Projektkontexts lässt sich daraus ableiten, was funktioniert und was nicht.
Wie funktionieren Monitoring und Evaluation?
Monitoring und Evaluation sind integrale und standardisierte Teile der Bemühungen der Welthungerhilfe, die Qualität und die Wirkung ihrer Arbeit ständig zu verbessern. Während das Monitoring vor allem der engmaschigen Reflexion der Frage der Zielerreichung dient und ein projektinternes Arbeitsinstrument ist, nimmt sich die Evaluation die Frage der Wirkungskontrolle und weiterer Evaluationskriterien (Relevanz, Effizienz, Nachhaltigkeit, Effektivität) mittels einer Beurteilung durch unabhängige GutachterInnen im Laufe oder zum Ende eines Projektes an.
Evaluationsergebnisse müssen dabei durch angemessene, wissenschaftliche Methoden erhoben worden sein und auf nachvollziehbaren Daten und Aussagen der Beteiligten beruhen. Die Evaluationen liefern Empfehlungen, wie sich ein Projekt verbessern lässt. Die Mitarbeiter, Partner, weitere Beteiligte sowie die Fachabteilungen in der Zentrale reflektieren diese Empfehlungen kritisch, setzen sie möglichst unmittelbar um und integrieren sie in die zukünftigen Projektplanungen.
Sowohl im Monitoring als auch in der Evaluation ist außerdem die Frage relevant, ob es neben den geplanten auch ungeplante möglicherweise negative Folgen gibt und wie sich in der verbleibenden Projektlaufzeit oder in Folgeprojekten gegensteuern lässt.
Um dem Anspruch des Lernens und der Rechenschaft zu genügen, werden die Ergebnisse des Monitorings und der Evaluation je nach Verwendungszweck und Zusammenhang dokumentiert und in angemessenen Foren analysiert. Für die Welthungerhilfe essentiell in Sachen Rechenschaftsplicht und Transparenz: die Veröffentlichung von Zusammenfassungen aller Evaluationsberichte.
Über dieses Formular können Sie anonym unethisches Verhalten von Mitarbeitenden melden.
Ethisch verantwortungsvolle Projektarbeit
Die Teams der Welthungerhilfe arbeiten mit sehr vulnerablen Menschen in oftmals fragilen Kontexten zusammen, daher hat das ethisch verantwortungsvolle Planen, Implementieren und Evaluieren für die Organisation einen besonders hohen Stellenwert.
Dies setzt kritische Reflexion und klare Rahmen voraus für das Verhalten von Mitarbeitenden. Dazu gehört auch, den Menschen im Projekt die Möglichkeit zu geben, sich zu beschweren.
Der CHS (Core Humanitarian Standard) ist der internationale Standard für Qualitätsverbesserung durch Rechenschaftslegung gegenüber projektbeteiligter Bevölkerung. Der CHS beinhaltet:
- Einbeziehung von Projektbeteiligten bei Planung, Durchführung und Bewertung der Projekte
- Transparente Kommunikation über die Organisation (Wofür steht sie? Woher kommt das Geld?) und ihre Arbeit (Was plant sie? Wie lange bleibt sie?)
- Die Bereitstellung von Beschwerdemechanismen (wenn das Projekt nicht gut läuft, nicht sinnvoll ist oder unethisches Verhalten von Mitarbeitenden beobachtet wird.)
Die Welthungerhilfe ist Gründungsmitglied der CHS Alliance.
Wer ist verantwortlich für das Qualitätsmanagement?
Die Landesbüros kümmern sich um das Qualitätsmanagement der Projekte, während die Zentrale mit fachlicher Beratung zur Seite steht. Gemeinsam werden Standards in den Bereichen Monitoring, Evaluation, Accountability sowie Arbeitshilfen erarbeitet.
Mitarbeiter*innen in der Zentrale führen zudem strategische Evaluationen durch. Die Gegenstände strategischer Evaluationen hängen von dem jeweils aktuellen Entscheidungsbedarf der Welthungerhilfe ab. In regelmäßigen Abständen finden Meta-Evaluationen statt: Wie gut funktionieren Monitoring und Evaluation? Wie lässt sich die Accountability verbessern?
Im Zuge des organisationsweiten Monitorings und damit einhergehenden Informationen zu Standardindikatoren kommt der Zentrale eine weitere wichtige Rolle im Rahmen des Qualitätsmanagments zu.
So stellen wir die Qualität in der Humanitären Hilfe sicher
Bei unseren Nothilfe-Aktivitäten folgen wir international anerkannten humanitären Standards, wie dem Core Humanitarian Standard on Quality and Accountability, den SPHERE-Standards und dem Code of Conduct der internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften. Wir verpflichten uns außerdem, die Qualität unserer Nothilfemaßnahmen laufend zu überwachen, indem wir sie während und nach ihrer Durchführung sorgfältig reflektieren und analysieren. Unser Ziel ist immer, unsere flexible Nothilfe-Struktur und unsere Maßnahmen weiter zu verbessern, um die betroffenen Menschen künftig noch effektiver und effizienter zu unterstützen.
Dieses Ziel verfolgen wir auch gemeinsam mit unseren humanitären Partnern. Ihre Nothilfe-Aktivitäten korrdiniert die Welthungerhilfe zum Beispiel eng mit Mitgliedern des Alliance2015-Bündnisses und dem Start Network.